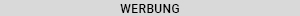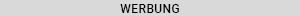Heisses Eisen im Dreiländereck: Ist schon im 2022 die «Hochpreisinsel Schweiz» Geschichte?
Und hier mal wieder eine gute Nachricht mit Hinblick aufs Jahr 2022: Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten dürfen sich freuen, denn die «Hochpreisinsel Schweiz» ist bald Geschichte. Zumindest bei vielen Gütern, die bisher gnadenlos überteuert angeboten wurden und auch bei welchen mit Hinweis auf die Kaufkraftklasse der Schweizerinnen und Schweizer das Pricing nicht mehr in dieser Form aufrecht behalten werden kann. Aber zu früh darf man die Aufhebung der Preisunterschiede nicht feiern. Diese werden dennoch bleiben, wenn auch nicht so hoch wie bisher. Der Einkaufstourismus im Dreiländereck wird weiterhin florieren.

Generalimporteure und ausländische Lieferanten missbrauchen seit Jahren ihre Marktstellung: Viele Produkte sind in der Schweiz massiv teurer als im EU-Umland. So heisst es in einer vor drei Jahren erfolgten aufwändigen Recherche der Konsumentenmagazine Kassensturz und Espresso. Die «Fair-Preis-Initiative» will deshalb schon seit Jahren Abhilfe schaffen – und die Hochpreisinsel Schweiz versenken. Nun haben Bundesrat und Parlament im Frühling das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und das Kartellgesetz als indirekten Gegenvorschlag zur «Fair-Preis-Initiative» angepasst. Diese Initiative wurde einst von einem breiten Bündnis aus Gastronomie, KMU und Konsumentenschutz lanciert und dann zugunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen. Dieser wird am 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt, was zu entsprechenden Gesetzesänderungen führt.
Relativer Marktanteil mit einem «Schweiz-Zuschlag»
Wie kam es überhaupt dazu, dass die Schweiz und speziell die Grenzregionen zu Hochpreisinseln wurden? Entgegen der landläufigen Annahme läge es nicht nur an den heimischen Verkäufern. Es seien oft Generalimporteure und ausländische Lieferanten, die Schweizer Händlern Preise mit einem «Schweiz-Zuschlag» in Rechnung stellen.
Natürlich gibt es objektive Kriterien, die ein leicht höheres Pricing bei vielen Gütern rechtfertigen: Zum Beispiel hohe Löhne und Bodenpreise (Miete oder Kauf der Location oder eines POS) oder strenge Produktvorschriften. Der Lobby-Verband der Markenartikelhersteller «Promarca» führte zuweilen vor allem auch höhere Werbeausgaben ins Feld, um die höheren Preise zu erklären. Zudem seien in der Schweiz, mit ihrer im Vergleich geringeren Einwohnerzahl, die Skaleneffekte tiefer als etwa in dem rund zehnmal bevölkerungsreicheren Deutschland. Als weitere Faktoren werden «strengere umwelt- und sozialpolitische Regelungen» und hohe Zölle erwähnt. Die Markenhersteller und Detailhändler betonen natürlich gebetsmühlenartig die höheren Schweizer Preise als Folge von höheren Löhnen, Mieten und Transportkosten. Auch der vergleichsweise kleinere Markt sowie die bereits erwähnten Handelseinschränkungen seien entscheidend. Das BAK Basel, ein unabhängiges Forschungsinstitut der Universität Basel, hatte bereits 2010 im Auftrag der grossen Schweizer Detailhändler die Preisunterschiede analysiert. Dabei wurde auch auf Folgendes verwiesen: Das hohe Ausbildungsniveau, die hohe Innovationskraft und, wie bereits schon aufgezählt, die hohen Löhne und Mieten spiegeln sich in den Preisstrukturen nieder. Vielerorts spreche man deshalb eher von einer «Hochkosteninsel».
Fakt ist: Der Schweizer Detailhandel muss die gleichen Waren viel teurer einkaufen als seine Konkurrenten in den umliegenden Ländern und so sind die höheren Beschaffungskosten eine logische Folge. Nur minim höher jedoch ist in der Schweiz der Kostenanteil von Mieten, Transport, Energie und Werbung. Ein weiterer Aspekt: Das Phänomen Geoblocking. Man kann oftmals Produkte nicht direkt bei ausländischen Anbietern zu dortigen Preisen kaufen. Online wird man beim Besuch von ausländischen Websites auf Schweizer Seiten umgeleitet.

«Geoblocking» und die Folgen
Die nun in Kraft tretenden Gesetzesänderungen gegen unlauteren Wettbewerb führen zu einem Verbot von Geoblocking und der Gefahr einer Zivilprozess-Anklage und Busse für fehlbare Unternehmen beziehungsweise Anbieter. Dies wird einen Effekt haben. Im Clinch sein werden hierbei wohl jene, die gezwungen sind, Produkte zu höheren Preisen bei Schweizer Niederlassungen zu kaufen, weil sie vom Ausland gar nicht beliefert wurden. Was jedoch möglich erscheint: Die Meldung an die Wettbewerbskommission (Weko), wenn ein Lieferant Druck ausübt und seine «relative Marktmacht» ausnützt. Zur Erklärung: Unternehmen, die nicht generell marktbeherrschend sind, jedoch einer oder mehrere Abnehmer von der Belieferung durch ein ganz bestimmtes Unternehmen abhängig sind, gelten als «relativ marktmächtig».
Für alle, die bereits jubeln und eine sofortige Preisreduktion auf alle Produkte mit dem «Schweizer Zuschlag» erwarten, sei erwähnt: So schnell werden die Preisunterschiede nicht verschwinden. Die Anpassung wird eher ein mittelfristiger Prozess, wie Ökonomen und Fachleute in den jeweiligen Branchen beurteilen.
In einer Studie an der Fachhochschule wurden übrigens die Preisunterschiede zwischen der Schweiz und den Nachbarländern im Jahr 2020 untersucht (diverse Quellen: SF, BaZ, BAK Basel u.a.) mit Fokus auf die Gütergruppen, bei welchen mittels Geoblocking oder Lieferverweigerungen der ausländischen Anbieter direkte Einkäufe von Konsumenten und KMU verhindert werden. Grosse Preisunterschiede hat es zur Folge bei Pflegeprodukten (kosten durchschnittlich 57 Prozent mehr), für Gastronomieprodukte (kosten durchschnittlich 48 Prozent mehr) oder bei Kleidern (kosten durchschnittlich 38 Prozent mehr). Die höchsten Preisunterschiede seien jedoch bemerkt worden für Produkte, die mit Innenausbau oder für die Innenausstattung zu tun haben. Darunter fallen Sanitärprodukte (Duschen, WC, Badewannen etc.), die bis zu 90 Prozent teurer seien als in Deutschland. Und Spülmaschinen und Kühlschränke seien, so die Studie, bei den Herstellershops in der Schweiz sogar fast 200 Prozent teurer als im «grossen Kanton». Gewisse Preisunterschiede würden zwar auch in Zukunft bleiben, heisst es weiter betreffend der genannten Quellen. Denn mit den Produkten verbundene Serviceleistungen in der Schweiz bleiben weiterhin teurer.
Zu viel Einkaufstourismus
Gleichzeitig soll mit dem neuen Gesetz auch dem übertriebenen Einkaufstourismus der Kampf angesagt werden: Basler, Genfer und Tessiner führen diese Einkaufstourismus-Liste an. In Basel hatte man bereits 2014 unter dem Brand «Shopping City Basel» bei der Pro Innerstadt proaktiv Werbung in Frankreich betrieben. Elsässer seien nämlich weniger preissensibel als die Südbadener. Sie scheinen das Einkaufserlebnis in der Basler Altstadt zu lieben, hiess es damals von Seiten von Pro Innerstadt in einigen Statements. Das Leben in Frankreich sei auch relativ teuer und man reagiere weniger empfindlich auf die Schweizer Preise. Das hat sich aber seitdem auch wieder dem Deutschen Niveau angepasst.
JoW